 Salix alba
Salix alba
"Da die weiße Weide in den meisten Gegenden die gemeinste und stämmigste ist, so wird die
Weidenrinde mitunter auch wohl von ihr genommen werden, besonders von der Dotterweide
(Cortex Salicis vitellinae) , der man auch wohl noch ganz besondere Wirkungeu zutraut, wie
denn auch Günz die Brauchbarkeit derselben zum Arzneigebrauch schon nachgewiesen bat.
Ehedem hatte man sogar ein destillirtes Wasser der Kätzchen und gab überhaupt viel auf die Heilkraft
der Theile des Baumes. Wolle und Seide werden zimmtbraun durch Rinde und Blätter gefärbt.
Das Holz zeigt unter allen Weiden den größten Zuwachs, ist aber sehr brüchig, schwerspaltig und
leicht faulend und giebt weder Hitze noch Kohlen, steht daher selbst dem Pappelnholze nach, dem es
sonst im Bau sehr gleicht. Auch diesen Baum erzieht man zu Kopfholz."
(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Dreizehnter Band, 1837)
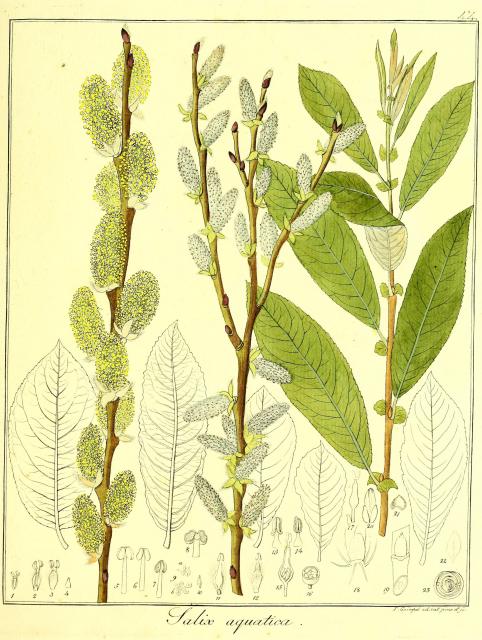 Salix aquatica (Salix cinerea)
Salix aquatica (Salix cinerea)
"Diese gehört zwar zu den kleineren Weiden, da sie aber in vielen Gegenden so außerordentlich
häufig ist und wahre Bestände bildet, wie z. B. in den Elbgegenden, so konnte sie hier als Weidenrinde
gebend, nicht übergangen werden. Sie ist ja auch der S. Caprea so ähnlich, dass man
gleiche Wirkungen mit derselben eiwarten kann.
Auch ihr übriger Nutzen ist nicht unerheblich, denn sie kann, da sie so häufig vorkommt,
eben so wie andere Weiden, zu sogenannten Wasen gebunden, als Brennholz benutzt werden. Zum
Befestigen von Dämmen und als Material für Korbflechtcr ist sie ebenfalls nützlich."
(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Dreizehnter Band, 1837)
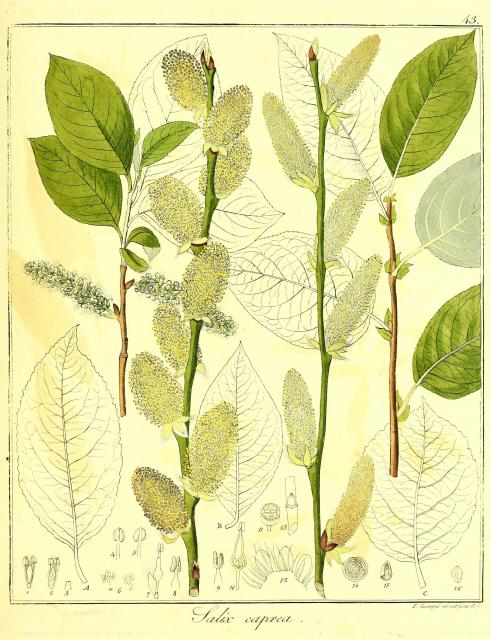 Salix caprea
Salix caprea
"Die Rinde der Saalweide dürfte nicht bloß beim Einsammeln von Weidenrinden in manchen
Gegenden ganz zufällig mit unterlaufen, sondern sie wurde sonst auch als Cortex Salis Capreae besonders
gesucht und als heilkräftig geschätzt. Wenn man jetzt auch keinen solchen Unterschied mehr
macht, so dürfte sie hier bei der vollständigen Aufzählung der zum arzneilichen Gebrauche dienenden
Weiden doch nicht übergangen werden.
Uebrigens hat diese Weide noch mancherlei Nutzen. Da sie meist zu einem Baume anwächst,
so ist ihr Holz nutzbarer als das vieler andern Arten. Es dient sowohl als Werkholz bei der Fabrikation
von Büchsen und Schachteln, als auch als Brennholz. Die Kohlen sind als Reißkohlen gut zu
gebrauchen, eigneu sich, nächst denen des Faulbaumes, am besten zur Bereitung des Schiffspulvers.
Die Rinde der 3- bis 4-jährigen Aeste soll zum Gerben des Leders der Dänischen Handschuhe gebraucht
werden, und mit Erlenrinde vermischt, Leinengarn schwarz färben. Allgemein bekannt ist
der Gebrauch der blühenden Zweige ( Palmzweige),
welche am Palmsonntage zur sogenannten
Palmweihe getragen werden. In katholischen Ländern steckt man diese auf die Saatfelder und glaubt
die Hagelwetter dadurch abzuhalten. Auch werden wohl dann drei Kätzchen als Schutzmittel gegen
Fieber verschluckt. Ob sie diesen Nutzen haben, steht dahin, aber den Bienen nutzen sie gewiss sehr
wenn sie recht voll blühen, und man sieht unzählige in den duftenden Zweigen geschäftig summend."
(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Dreizehnter Band, 1837)
 Salix fragilis
Salix fragilis
"Von der Bruchweide und der Lorbeerweide soll nach der Preuß. Pharmakopoe die officinelle
Weidenrinde genommen werden. Die Bruchweide dürfte dazu auch wegen ihrer Häufigkeit
am Besten zu benutzen seyn. Die Rinde hat sogar einen angenehmen balsamischen Geruch. Der
Baum wird überdies noch sehr nützlich dadurch, dass er an Wegen gebraucht werden kann und später
erträgliches Brennholz liefert. Will man bei der Anpflanzung desselben seine Zweige und zugleich
die Weide unter den Bäumen nutzen, so behandelt man ihn als Kopfholz. Die Wurzeln sollen, wenn
sie lange gekocht werden, eine purpurrothe Farbe geben."
(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Dreizehnter Band, 1837)
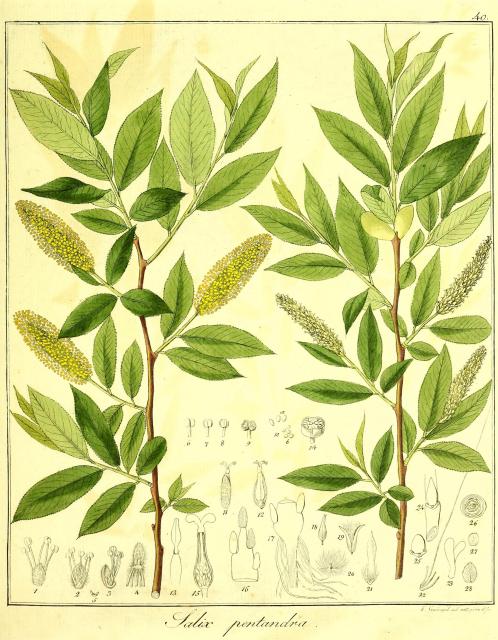 Salix pentandra
Salix pentandra
"Auch von der Lorbeerweide sammelt man Weidenrinde, ja man unterscheidet
diese wohl gar als Cortex Salicis pentandrae seu laureae , und zieht diese, wenn man sie haben
kann, vor zum Arzneigebrauch, besonders zur Bereitung des Extracts, welches die dunkelbraune Farbe
des Chinaextracts hat. Sünz vergleicht sie mit der Chinarinde, welche weniger flüchtige und schleimige, aber mehr harzige und erdige
Bestandtheile enthalten soll. Selbst im Volke gelten Rinde und Laub der Lorbeerweide als vortreffliche
Heilmittel, nicht bloß beim Fieber, sondern auch bei Entzündungen, Geschwüren u. dergl.
Die Blätter, welche gelbe Farbe geben sollen, gewähren ein herrliches Viehfutter. Die jungen Triebe
sind zähe und dienen zum Binden, Flechten u. s. w. Die Haarwolle ist die längste und feinste und soll
hier und da mit Baumwolle gemischt, zum Weben gebraucht werden (thüringische, märkische oder
schlesische Baumwolle genannt). Das Holz ist fest und zähe. Unter allen Weiden eignet sich diese
am meisten zu einem Zierstrauche in Gärten, auch wegen des steten Wohlgeruches der Blätter."
(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Dreizehnter Band, 1837)
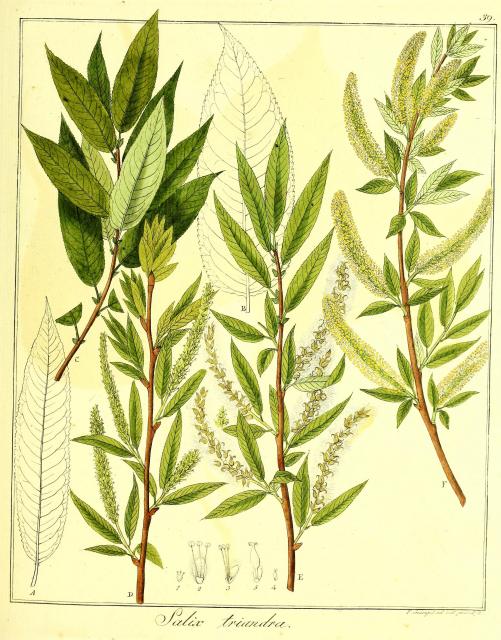 Salix triandra
Salix triandra
"Von dieser Weide, wie von den übrigen, unter den nachfolgenden Nummern beschriebenen,
wird vorzüglich die Rinde gesammelt, welche als Weidenrinde (Cortex Salicis) noch jetzt officinell
ist. Man sammelt sie im Frühjahre, sobald sie sich löst, und zwar
von den zwei- bis dreijährigen Aesten, auch nicht von einem zu nassen Standorte, und trocknet sie
im Schatten. Die alsdann zusammengerollte Rinde der dünnen Aestchen ist dünner, glatter, glänzender,
brauner, die der ältern dicker rissiger, matter und grauer. Die innere, glattere Seite ist stets
heller als die äußere. Der Geruch derselben ist unbedeutend, der Geschmack aber bitter, selbst etwas
aromatisch und hinterher zusammenziehend, besonders bei älterer Rinde, die aber wieder weniger bitter
ist. ...
Man reicht die Weidenrinde als Pulver zu 2 — 3 St., oder bereitet daraus eine Abkochung
(6 —8 Dr. auf 8 Unzen), oder ein Extract, welches letztere zu 20—30 Gr. in Pillenform gegeben
wird. Die Wirkung dieser Mittel ist zusammenziehend, sogar noch mehr als die der Kastanienrinde.
Man hat durch sie die Chinarinde ersetzen wollen, und wenn dies auch nicht vollkommen geglückt
ist, so thut sie doch zuweilen gute Dienste gegen Wechselfieber, besonders bei großer Erschlaffung und
Atonie, auch bei passiven Schleim- und Blutflüssen, Durchfällen aus Erschlaffung und Wurmkrankheiten.
Aeußerlich kann man sie auch zu Umschlägen bei (Quetschungen), zu Einspritzungen und selbst
zu Salben gebrauchen.
Die Buschweide gehört auch in technischer Hinsicht zu den nützlichsten. Man kann sie, wegen
der außerordentlich lebhaften Ausschlagsfähigkeit, zu Flechtzäunen und Faschinen benutzen und
ihre langen Triebe geben dann schöne zähe Ruthen für Korbflechter."
(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Dreizehnter Band, 1837)
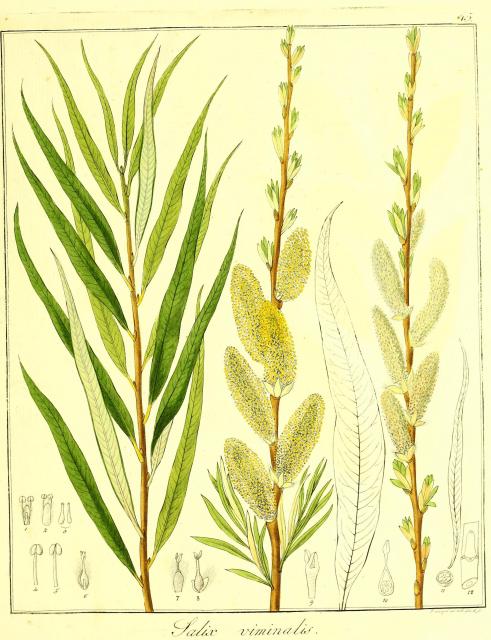 Salix viminalis
Salix viminalis
"Auch die Korbweide darf für unsern Zweck nicht unberücksichtigt bleiben. Sie ist in vielen
Gegenden, da wo Ufer- oder Festungsarbeiten betrieben werden, so außerordcntlich häufig, auch auf
gutem Boden so stämmig, dass man leicht gezwungen werden dürfte, von ihr den Hauptbedarf für die
Apotheke zu nehmen. Dazu kommt noch, dass die leicht zu schälende Rinde äußerst saftig und aromatisch
ist und besonders kräftige Wirkungen verspricht. Ihre Blätter werden vom Vieh besonders
gern angenommen. Unter den Befestigungsweiden steht sie oben an, denn sie schlägt am Tiefsten aus
Stecklingen aus und macht die größten Triebe, bis 13 Fuß Höhe in einem Jahre! Diese Triebe, auf
gutem Boden einen undurchdringlichen Wald bildend, sind sehr zähe und biegsam und haben ihr auch
wegen ihrer Brauchbarkeit zu Fischerkörben u. s. w. die Namen Fischer- oder Korbweide verschafft.
Ueberdies sieht man sie wegen der schönen Form und des Silberglanzes der Blätter sehr gern."
(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Dreizehnter Band, 1837)