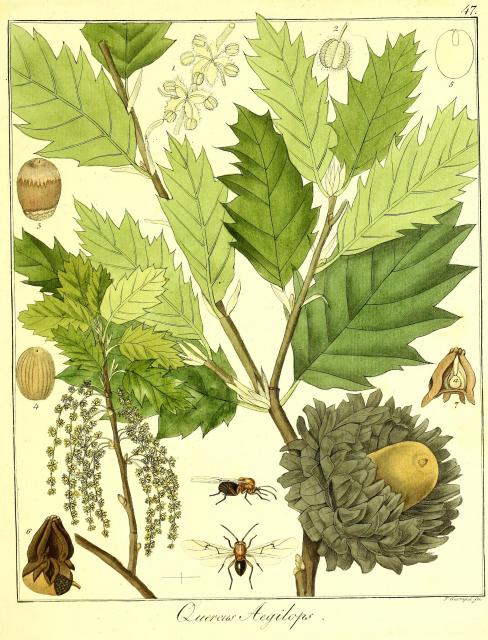 Quercus aegilops (Quercus ithaburensis)
Quercus aegilops (Quercus ithaburensis)
"Quercus Aegilops soll die sogenannten Knoppern liefern. ...
Die Knoppern werden, so wie die geringeren Arten der Galläpfel, nur noch in der Färberei
benutzt. Die Knoppern haben aber sowohl vor den Galläpfeln, als auch vor der Lohe den Vorzug,
dass sie ungleich besser adstringiren und das Leder um den fünften bis sechsten Theil der Zeit
geschwinder gar machen. Daher werden sie auch in Ungarn so sehr geschätzt, und ein Misswachs
derselben ist dort sehr empfindlich ..."
(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Zwölfter Band, 1833)
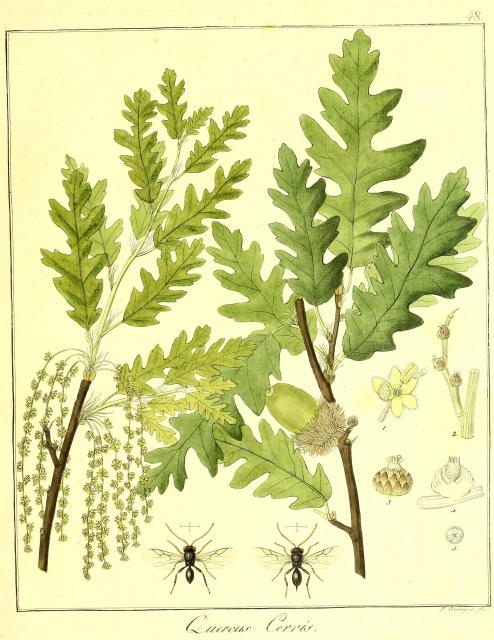 Quercus cerris
Quercus cerris
"Von Quercus Cerris soll die schlechtere Sorte der Galläpfel kommen, welche man die Französischen
oder Istrischen nennt. ...
Diese Sorte von Galläpfeln wird für schlecht gehalten, dürfte aber auch als seltener bei uns
vorkommende nicht oft zu Klagen über Verwechselungen Anlass geben."
(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Zwölfter Band, 1833)
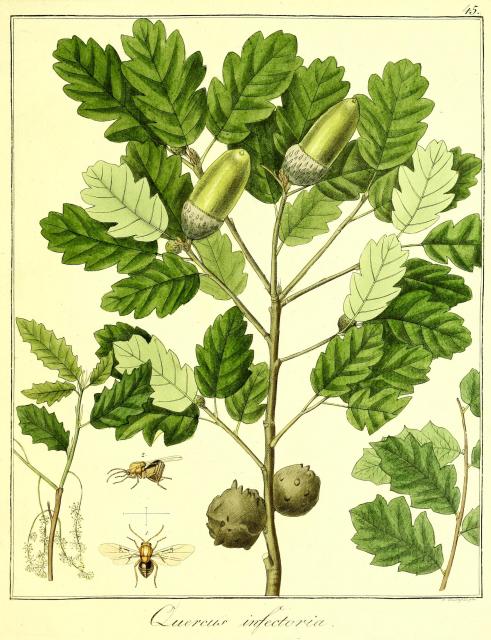 Quercus infectoria
Quercus infectoria
"Seit Olivier’s Reise nennt man als Mutter-Gewächs der bekannten Levante’schen Galläpfel
die Quercus infectoria. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass diese Galläpfel von mehreren Eichen-
Arten abstammen, und dass selbst in der Levante mehrere specifisch verschiedene strauchartige
Bäume dieser Gattung wachsen, von denen Galläpfel gesammelt werden. ...
Die Galläpfel (Gallae) sind holzige Auswüchse der Aestchen und werden durch die Cynips
Quercus infectoriae Nees v. Eschbeck (Diplolepis Gallae infectoriae Oliv.) erzeugt, welche mittelst
eines langen Legestachels ihre Eier zur Seite und am Ende der Aeste ablegt, wodurch ein
Austritt der Säfte entsteht und durch das Wachsen und die Verwandlung der Larve vergrößert
wird. ... Die andern kleinen Insecten (z. B. Diplolepis splendens) , welche man
wohl hier und da in den Galläpfeln noch vorfindet, und die sich durch Metallglanz auszeichnen,
leben als Schmarotzer von der Cynips. Die Gestalt der Galläpfel ist meist kugelrund, und auf der
Oberfläche sind sie mehr oder weniger mit Höckerchen, Narben und Unebenheiten besetzt. In der
Mitte derselben findet sich immer eine Höhle. Nach dem verschiedenen Alter — und dem davon
abhängenden verschiedenen Entwickelungszustand des darin lebenden Insects — erscheinen sie verschieden.
... Einmal die Größe uud dann besonders die Farbe ist es welche zur Unterscheidung
der Sorten dient. Es werden drei solcher Sorten von den Drogisten unterschieden : 1. Gallus
niger, 2. Gallus viridis, und 3. Gallus albus. Die ersteren werden auch wohl Türkische oder
Levantesche Galläpfel (Gallae Turcicae) genannt, unter denen dann wieder die besten die
Mosoulischen und Aleppisehen (Gallae de Aleppo s. Aleppenses)
und die schlechteren die
Tripolischen und Smyrni sehen sind. ...
Der Geruch der Galläpfel ist eigentümlich gewürzig, fast pfefferartig, und der Geschmack
herbe, zusammenziehend, tintenhaft. Letztere Eigenschaft verdanken sie dem Gerbstoff. ...
Wegen ihrer bedeutenden adstringirenden Wirkung haben sich die Galläpfel für einen mehrfachen
Gebrauch empfohlen. Innerlich giebt man sie jetzt nicht mehr so wie früher bei hartnäckigen
Durchfällen, Blutflüssen, sondern nimmt sie jetzt nur noch in Vergiftungsfällen, welche
adstringirende Mittel indiciren, und dann besonders äußerlich in Aufgüssen oder Abkochungen zu
Einspritzungen, Umschlägen etc. gegen Blutflüsse, Gcschwüre u. s. f. Als chemisches Reagens ist
die Galläpfeltiuctur unentbehrlich, auch geben die Galläpfel die beste schwarze Tinte."
(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Zwölfter Band, 1833)
 "Stiel-Eiche, langstielige Eiche, Früheiche, Sommereiche, Augusteiche, Austeiche, weibliche
Eiche, Fraueneiche, breitblättrige Eiche, Loheiche, Masteiche, Haseleiche, Rotheiche,
Tanneneiche, Vierche, Vereiche, Ferkeleiche, Fürkeleiche, Waldeiche, Heister, Drudenbaum,
Druidenbaum.
"Stiel-Eiche, langstielige Eiche, Früheiche, Sommereiche, Augusteiche, Austeiche, weibliche
Eiche, Fraueneiche, breitblättrige Eiche, Loheiche, Masteiche, Haseleiche, Rotheiche,
Tanneneiche, Vierche, Vereiche, Ferkeleiche, Fürkeleiche, Waldeiche, Heister, Drudenbaum,
Druidenbaum.
Wächst in ganz Deutschland und in den übrigen Ländern, von Europa, mit Ausschluß der
nördlichsten, in Wäldern.
Blühet im April und May.
Sowohl an dieser als auch an der vorhergehenden Art [Quercus robur] findet man Galläpfel, die durch den
Stich und Einlegen des Eychens der Gallwespen entstehen, und zwar geschieht dies von einigen
Arten dieser Thierchen, als von Cynips Quercus corticis, Cynips Quercus petioli, Cynips Quercus
folii und Cynips Quercus pedunculi. In diesen Galläpfeln fand John Extractivstoff, Schleim, Harz, Gerbestoff, Gallussäure, gallussaures Kali,
phospkorsaures Eisen, eine salz- und schwefelsaure Verbindung und Wasser."
(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Sechster Band. 1855.)
 "Stein - Eiche, gemeine Eiche, Traubeneiche, Späteiche, Wintereiche, Winterschlageiche, Winterschlagholzeiche,
männliche Eiche, Trufeiclie, Treufeleiclie, Loheiche, Harzeiche, Eiseiche,
Rotheien, Yiereiche, Knoppereiche, Bergeiche, Grüneiche, Dürreiche, Schwarzeiche, Kohleiche,
Klebeiche, Spalteiche.
"Stein - Eiche, gemeine Eiche, Traubeneiche, Späteiche, Wintereiche, Winterschlageiche, Winterschlagholzeiche,
männliche Eiche, Trufeiclie, Treufeleiclie, Loheiche, Harzeiche, Eiseiche,
Rotheien, Yiereiche, Knoppereiche, Bergeiche, Grüneiche, Dürreiche, Schwarzeiche, Kohleiche,
Klebeiche, Spalteiche.
Wächst in ganz Deutschland, so wie auch in den übrigen Ländern von Europa, mit Ausschluss
der nördlichen, in Wäldern.
Blühet im May.
Man sammelt von Quercus Robur die Rinde, Cortex Quercus, welche von nicht zu alten
Zweigen genommen werden darf. Ferner bewahrt man die Früchte oder Eicheln, Glandes
Quercus , wenn sie von dem näpfchenförmigen Kelche sich getrennt haben, als Arzneimittel auf.
Wenn gleich in den meisten Pharmarcopöen nur Quercus Robur als das Gewächs vorgeschrieben
wird, von welchem jene Theile genommen werden sollen: so mag doch wohl eben so
oft, — ja in mancher Gegend noch öfter — die Einsammlung derselben von der Quercus pedunculata
Statt finden; wozu auch der Umstand, dass, wenn beyde Arten durcheinander wachsen,
von dieser die Früchte früher abfallen, nicht wenig bey trägt. Die Früchte wird man durch die
bauchig-längliche Gestalt leicht von denen der Quercus pedunculata, die walzenartig-länglich
sind, unterscheiden können. Beym Einsammeln der Rinde, was im frühen Frühjahre geschieht,
muß man auf die hin und wieder noch hängen gebliebenen Blätter achten, welche ein sicheres
Unterscheidungszeichen abgeben.
Die Rinde schmeckt etwas bitter und stark zusammenziehend. Sie enthält viel Gerbestoff
und nach Scheel’s Untersuchung auch sauerkleesauern Kalk. Nur selten wird sie innerlich gegeben;
äußerlich aber bedient man sich ihrer in der Abkochung als Mundwasser und zu Einspritzungen
bey Muttervorfällen. — Die Früchte werden geröstet und wie Kaffee zubereitet bey
Atrophie der Kinder gegeben. Auch sind sie für Erwachsene ein sehr wirksames Mittel bey verminderter
Muskelkraft, bey Schwäche der Lungen, in der Gicht, bey langwierigen Hautausschlägen
u. s. w. Sie befördern die Verdauung und sind dem Kaffee, mit dem sie mehreren Eigenschaften
nach Ähnlichkeit haben, darin gleich, dass sie, so wie er, das Gemüth erheitern."
(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Sechster Band. 1855.)
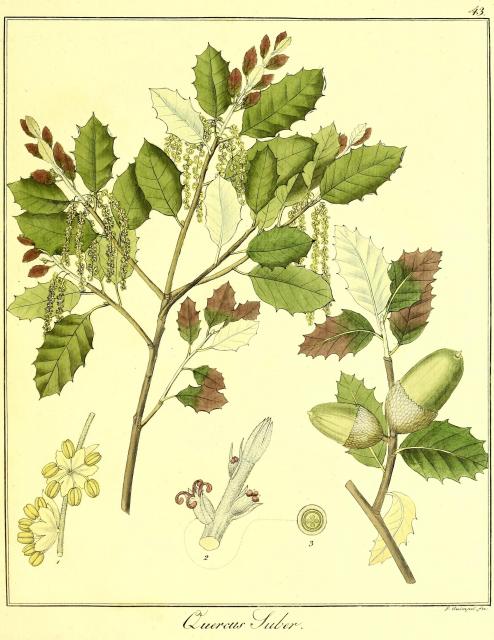 Quercus suber
Quercus suber
"Von Quercus Suber kommt der bekannte Kork (Suber), die schwammige, elastische, leichte,
bräunlich-gelbe, geruch- und geschmacklose, nur ihrer Oberhaut beraubte Rinde des Baums, welche
meist nur von alten Bäumen gebraucht und alle sieben, acht oder auch zehn Jahre von denselben
abgeschält wird. Da man sie presst, kommt sie in einen bis zwei Fuß breiten, und einen bis zwei
Zoll dicken Stücken zu uns. Die schwarze oder dunkelbraune Farbe der Oberfläche rührt von
der bei der Zubereitung üblichen Erhitzung über Feuer her. ...
In den Apotheken wird der Kork jetzt nur noch als Pfropfen zum Verschließen der Gläser
gebraucht, darf aber nicht mit Säuren und Alcalien in Berührung kommen, die ihn angreifen. Die
Korkkohle (carbo suberis, Nigrum hispanicum) eignet sich wegen ihrer leichten und lockern
Beschaffenheit und der glänzend schwarzen Farbe zu Zahnpulvern und zur Mischung schwarzer
Maler-Farben.
Außerdem ist auch der Kork zu mancherlei Dingen verarbeitet worden, z. B. zu Schuhsohlen,
Schiffsbeschlägen, Schwimmjacken u. s. f. Auch lässt sich außerordentlich zierlich darin arbeiten,
und man macht Landschaften und Modelle daraus."
(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Sechster Band. 1855.)